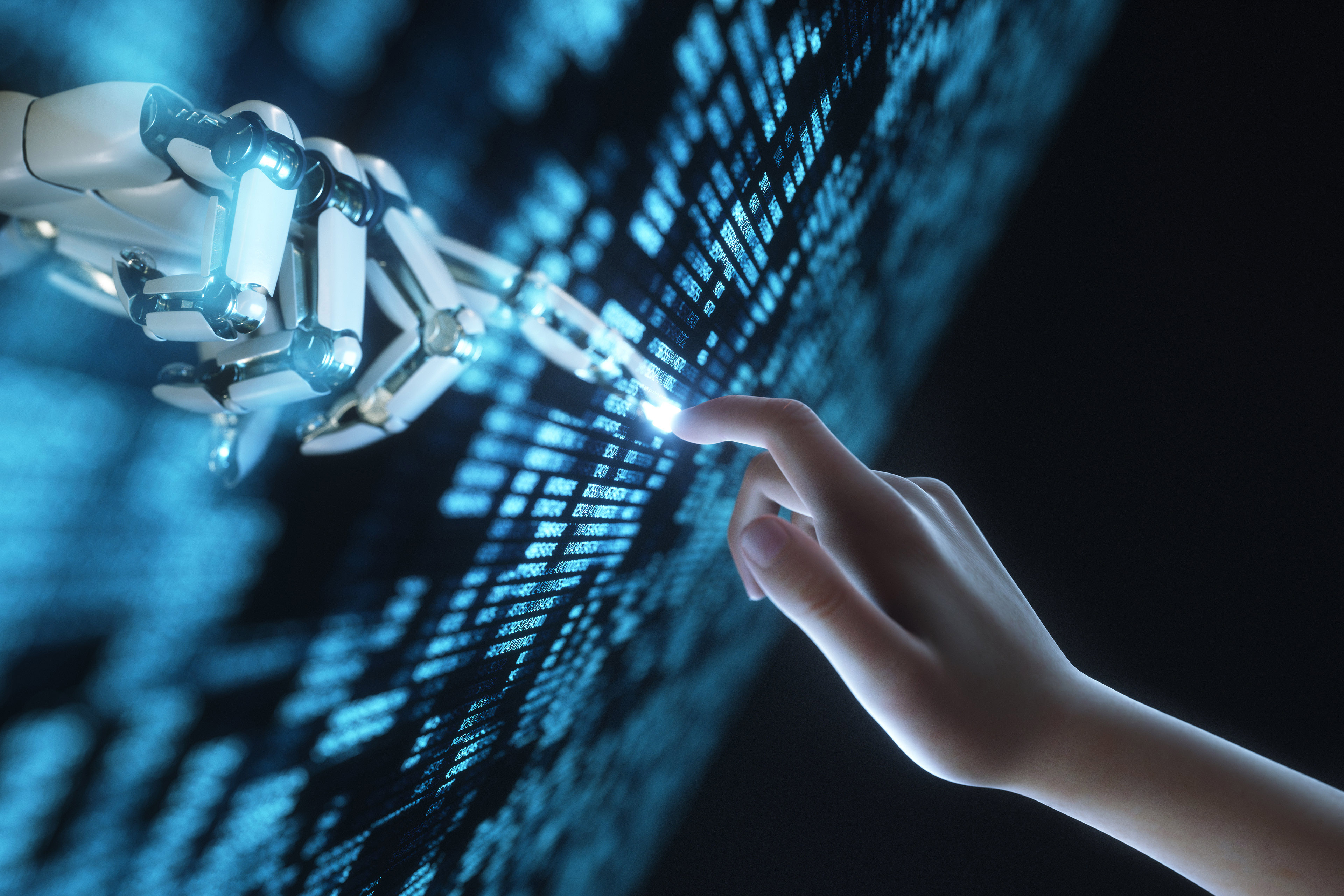Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden.
So unterstützen wir Sie
-
Nachhaltigkeitsberichterstattung schafft Transparenz und ist für viele Unternehmen verpflichtend • Wir helfen Ihnen, sich auf Vorgaben vorzubereiten. ➜ Jetzt kontaktieren!
Mehr erfahren
Höhere Schwellenwerte und weniger Berichtspflichten
Durch Änderungen im Anwendungsbereich der CSRD sollen künftig nur mehr große Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden – unabhängig von einer Kapitalmarktorientierung – und entweder einem Nettoumsatz von über 50 Mio. Euro oder einer Bilanzsumme von mehr als 25 Mio. Euro berichtspflichtig sein. Auch für Unternehmen aus Drittstaaten sollen die Schwellenwerte in Bezug auf die Berichtspflicht angehoben werden: Der Nettoumsatz innerhalb der EU muss 450 Mio. Euro überschreiten, während Betriebsstätten in der EU erst ab 50 Mio. Euro Nettoumsatz betroffen sein sollen. Eine Überarbeitung und Vereinfachung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ist laut der Initiative ebenfalls geplant, wodurch man eine deutliche Reduktion der zu berichtenden Datenpunkte anstrebt. Die Europäische Kommission hat EFRAG mit der Überarbeitung des ersten Satzes der ESRS beauftragt. Die Vorschläge sollen bis zum 31.10.2025 vorgelegt werden, um die Regelungen für Geschäftsjahre 2027 (ggf. auch freiwillig für 2026) zu ermöglichen.
Auf eine Ausarbeitung der sektorspezifischen Standards wird verzichtet. Zudem sollte, was die Wertschöpfungskette betrifft, keine Verpflichtung mehr zur Einholung von Daten von Nicht-CSRD-Unternehmen bestehen.
CSRD-Umsetzung verzögert: Was das Stop-the-Clock-Prinzip bedeutet
Die Anwendung für die zweite Welle der berichtspflichtigen Unternehmen – also jene, die bis dato noch keinen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen mussten – wurde um zwei Jahre verschoben, sodass eine erstmalige Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2027 (statt bislang 2025) ansteht. Der Vorteil von „Stop-the-Clock“ ist, dass es mehr Zeit für die Anpassung interner Prozesse, aber auch für die Entwicklung von Strategien und generell für die Vorbereitung des Reportings gibt. Für kleine und mittelgroße Public-Interest-Entitys (PIEs – Unternehmen von öffentlichem Interesse), die zu den Welle-3-Unternehmen zählen, verschiebt sich die Berichtspflicht auf das Geschäftsjahr 2028. Da eine Anhebung der Schwellenwerte bislang nur vorgeschlagen ist, besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Unternehmen – wie kleine und mittelgroße PIEs – künftig nicht mehr in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. Für große PIEs, die gemäß CSRD bereits für das Geschäftsjahr 2024 berichtpflichtig waren, wird das Stop-the-Clock-Prinzip nicht angewandt, sie bleiben also gemäß CSRD berichtspflichtig, wie gehabt.
Neuer freiwilliger Berichtsstandard für KMU geplant
KMU sind nach dem Omnibus-Vorschlag weitgehend nicht mehr von der CSRD betroffen. Dennoch bleiben Themen wie Marktglaubwürdigkeit, diverse Anforderungen innerhalb der Lieferkette und weiterer Stakeholder:innen sowie die Vorbereitung auf mögliche zukünftige Reporting-Bedingungen weiterhin bedeutend. Für sie soll ein freiwilliger, neuer Berichtsstandard erarbeitet werden, der sich an dem bereits ausgearbeiteten VSME-Standard (freiwillige Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für mittelständische Unternehmen) orientiert. Den Unternehmen außerhalb des CSRD-Anwendungsbereichs wird damit ein Rahmenwerk für die Beibehaltung von Nachhaltigkeits- und Berichterstattungspraktiken zur Verfügung gestellt.